Obsternteaktion im Garten
Obsternteaktionen bieten älteren Menschen vielfältige Möglichkeiten, aktiv und engagiert den Alltag zu gestalten. Garten- und Ernteerlebnisse sprechen alle Sinne an – sie liefern frische Luft, Farben und Düfte und regen so körperliches und seelisches Wohlbefinden an. Bei der Ernte oder der Verarbeitung von Obst werden Erinnerungen geweckt: Viele Menschen sind in ihrer Jugend auf dem Land aufgewachsen oder haben in eigenen Gärten gearbeitet, weshalb bekannte Düfte und Handgriffe alte Bilder und Geschichten ins Bewusstsein holen. Das Schneiden und Sortieren von Äpfeln, Birnen oder Beeren ist zudem motorisch aktivierend: Es fördert die Feinmotorik, trainiert Muskeln und stärkt das Gleichgewicht.
Gleichzeitig bereitet die gemeinsame Arbeit im
Garten oder auf der Streuobstwiese Freude und gibt ein Gefühl der
Gemeinschaft. Während der Obsternte können sich Mitarbeitende, Bewohner
und Ehrenamtliche austauschen und gemeinsam Erfolgserlebnisse feiern. So
wie bei einem Kursana-Projekt im Herbst, als Senioren mit großem Eifer
Marmelade kochten – sie schnippelten Obst zusammen, tauschten „rege
Erinnerungen“ aus und empfanden das gemeinsame Tun als gesellig. Solche
Aktivitäten steigern das Selbstwertgefühl, denn die Teilnehmenden sehen
direkt, dass sie etwas Nützliches tun können. Auch Familienangehörige
profitieren: Sie erleben ihre Angehörigen lebhaft und eingebunden in
sinnvolle Tätigkeiten – ein Kontrast zum oft monotonen Pflegealltag.
Insgesamt ermöglichen Obsternteaktionen, die vorhandenen Ressourcen
älterer Menschen zu nutzen und den Alltag mit Naturerlebnissen und
traditionellem Wissen zu bereichern.
(Hinweis auf Übersicht: Das Lexikon - Inhaltsverzeichnis)
Zielsetzung einer Obsternteaktion
Eine Obsternteaktion in einem Pflegeheim verfolgt vorrangig das Ziel, das körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden der Bewohnenden zu fördern. Im Rahmen der Gartentherapie wird Gartenarbeit gezielt eingesetzt, um Gesundheit und Lebensqualität zu verbessern. So können selbst Menschen mit Einschränkungen aktiv bleiben und Erfolgserlebnisse sammeln. Die Aktion soll die Sinne ansprechen (Geruch, Tastsinn, Sehen) und ein ganzheitliches Erlebnis bieten. Typische Ziele sind daher:
Aktivierung und Bewegung: Auch leichte körperliche Betätigung – Äpfel pflücken, Früchte sortieren oder pressen – fördert Beweglichkeit und Motorik. Regelmäßige Bewegung verbessert Mobilität und kann muskuläre und kardiovaskuläre Gesundheit unterstützen.
Kognitive Anregung und Erinnerungsarbeit: Das Wissen über Obstsorten und alte Rezepte wird aktiviert. Viele Ältere haben noch Kenntnisse aus der Kinder- oder Jugendzeit („Man hat damals Vorräte für den Winter angelegt.“) – dieses biografische Wissen lässt sich beim Obsternte-Projekt einbinden und abreufen.
Emotionale und soziale Teilhabe: Durch die gemeinsame Arbeit wird das Gemeinschaftsgefühl gestärkt. Ein Umfeld, in dem alle zusammenarbeiten, reduziert Einsamkeit und isolierte Stimmung. Soziale Interaktion entsteht ganz natürlich beim Pflücken, Kochen oder Essen der geernteten Früchte.
Strukturierung des Tagesablaufs: Die Aktion bietet Abwechslung im Pflegealltag. Der Einbezug saisonaler Rhythmen (z. B. Herbst-Ernte) bringt einen zusätzlichen Taktgeber für das Jahr und ermöglicht neue Rituale (Erntedankfest, gemeinsames Essen).
Förderung von Selbstwirksamkeit und Lebensqualität: Senioren haben oft das Bedürfnis, gebraucht zu werden. Durch die Übernahme von Aufgaben in Vorbereitung und Durchführung fühlen sie sich wertgeschätzt und erleben Selbstwirksamkeit.
Insgesamt dient die Obsternteaktion dazu, die Tagesstruktur sinnvoll zu ergänzen und zusätzliche pädagogisch-therapeutische Ziele zu erreichen. Sie orientiert sich an den Prinzipien altersgerechter Gartenarbeit und stellt das Ressourcen- und Bedürfnis-orientierte Handeln der Mitarbeitenden in den Vordergrund.
Vorteile und mögliche Nachteile eines solchen Angebots
Vorteile
Für die Bewohnenden:
Aktivierung aller Sinne und Biografiearbeit. Durch Gerüche (z. B. Apfelduft) und haptische Reize (Schälen, Schneiden, Pressen) werden Wahrnehmung und Gedächtnis stimuliert. Besonders demenzkranke Menschen profitieren davon, da die sinnliche Erfahrung Erinnerungen aktiviert.
Körperliche Förderung und Mobilität. Leichte Arbeiten im Garten oder im Heimkeller fördern die Beweglichkeit. Schon das Drücken des Obstpressenhebels oder Tragen von Obstkisten trainiert Muskeln und sorgt für körperliche Betätigung.
Psychische Stärkung. Die Teilnehmer erleben Spaß und Freude beim gemeinsamen Projekt: „Die eigene Ernte gemeinsam genießen“ steigert das Wohlbefinden und die Zufriedenheit. Das Erfolgserlebnis (der eigene Saft, Kuchen oder haltbarer Vorrat) stärkt das Selbstvertrauen und gibt Stolz auf die erbrachte Leistung.
Soziale Interaktion. Die Aktion fördert Gespräche, Lachen und Zusammenhalt unter den Bewohnenden. Wie in einem beschriebenen Projekt, in dem seniorinnen und Senioren Früchte schnippelten, wird die Arbeit oft zu einer geselligen Angelegenheit. Angehörige, die mithelfen oder das Resultat verkosten, erleben, wie ihre Familienangehörigen sich lebendig fühlen, was Beziehungen stärkt.
Für die Angehörigen:
Einbindung und Teilhabe. Angehörige können in Planung oder Durchführung eingebunden werden (z. B. Obstspenden, Begleitung bei Ausflügen), was das Miteinander fördert. Es entstehen auch Erinnerungen für die Angehörigen, wenn sie sehen, wie aktiv die eigene Mutter/der eigene Vater an früher erinnernde Tätigkeiten teilnimmt.
Entlastung und Vertrauen. Wenn die Einrichtung zeigt, dass sie vielfältige, anregende Angebote macht, schafft das Vertrauen. Die Beteiligung an festlichen Abschlussszenen (gemeinsames Kaffeetrinken mit Eigenprodukten) gibt Familien ein gutes Gefühl über die Lebensqualität der Bewohnenden.
Für das Personal (Mitarbeitende verschiedener Berufsgruppen):
Interdisziplinäre Zusammenarbeit. Eine Obsternteaktion kann als teamübergreifendes Projekt gestaltet werden – Pflegekräfte, Betreuungskräfte, Küche und Technik arbeiten zusammen. Das stärkt den Teamgeist und schafft gemeinsame Erfolgserlebnisse.
Abwechslung im Arbeitsalltag. Auch für die Mitarbeitenden ist eine solche Aktion eine willkommene Abwechslung zum oft fordernden Pflegealltag. Sie können ihr Fachwissen einbringen (Pflegekräfte begleiten behutsam, Küchenpersonal planen Rezepte) und lernen ihre Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen besser kennen.
Positive Außenwirkung. Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit über gelungene Aktionen steigern das Ansehen der Einrichtung und motivieren das Team. Ein Bericht einer Pflegeeinrichtung beschreibt etwa, dass nach einer großen Obsternte alle „fröhliche Gesichter“ hatten und stolz waren.
Mögliche Nachteile und Risiken
Körperliche Anstrengung und Sicherheit: Nicht alle Bewohnenden sind körperlich belastbar. Mobilitätseinschränkungen oder Sturzrisiken müssen berücksichtigt werden. Ohne ausreichende Hilfestellung (z. B. stabile Leiter, Unterstellstühle) kann das Pflücken zu anstrengend sein. Allergien gegen Pflanzen oder Insektenstiche sind möglich (z. B. bei Nüssen, Blumen); daher ist auf entsprechende Vorsorge zu achten.
Einschränkungen einzelner Personen: Einige ältere Menschen mögen bei Gemeinschaftsaktivitäten ungern im Mittelpunkt stehen oder sind sehr zurückhaltend. Ein überforderndes Programm könnte Ängste auslösen. Bei Demenz kann eine große Gruppe verwirrend wirken. Eine behutsame Betreuung und Klein-Gruppen-Angebote sind wichtig, damit sich niemand ausgegrenzt fühlt.
Wetterabhängigkeit: Außentermine unterliegen dem Wetter. Regen oder starke Kälte können Ernteaktionen verzögern. Abhilfe können Indoor-Varianten bieten (z. B. Tische im Atrium mit ausgestelltem Obst).
Zusätzlicher Aufwand: Die Planung und Organisation kosten Zeit. Mitarbeitende müssen ggf. Überstunden leisten oder sich auf mehrere Tage verteilen. Auch Kosten für Ausstattung (Einkauf von Pressen, Einmachgläsern) sind zu beachten.
Die Nachteile können aber durch gute Vorbereitung und Abwägung minimiert werden (z. B. seniorengerechte Tools, flexible Termine, freiwillige Teilnehmerschaft). Die positiven Effekte überwiegen meist deutlich, wenn Sicherheit und Ressourcen der Bewohnenden respektiert werden.
Planung, Organisation und Durchführung einer Obsternteaktion
Eine erfolgreiche Obsternteaktion erfordert gründliche Vorbereitung. Die Planung sollte etwa mehrere Monate im Voraus beginnen, damit alle Beteiligten eingebunden werden können. Folgende Aspekte sind zentral:
Zeitplanung und jahreszeitliche Orientierung: In Deutschland fällt die Apfelernte meist in den Spätsommer bis Herbst (August bis Oktober) – je nach Sorte und Witterung. Bei zentralen Sorten richtet sich der Erntezeitpunkt nach Sorte und Reifegrad. Plakate oder Kalender mit möglichen Ernteterminen sind hilfreich. Im Frühjahr hingegen eignet sich die Pflanzung oder Pflege (Schnitt) des Obstbaums oder Beetes. Die Aktion selbst kann mit saisonalen Festen gekoppelt werden: Ein Erntedankfest im Oktober bietet sich an. So wird die Obsternte (z. B. Äpfel) thematisch eingebettet.
Einsatzplan und Aktivitäten: Der Ablauf sollte klar definiert sein: Vor der Ernte werden Bäume kontrolliert, erntefertiges Obst gemeinsam besprochen, Hilfsmittel bereitgestellt. Während der Ernte bilden kleinste Gruppen, wobei manche Bewohnende am Pflücken teilnehmen (wenn möglich), andere beim Einsortieren ins Sammelgefäß helfen und wiederum andere beim Transport oder Nachbereiten (z. B. Waschen von Äpfeln). Wer nicht draußen mitgehen kann, sollte beim Trocknen von Kräutern oder Sortieren am Tisch mit eingebunden sein. Nach der Ernte folgt die Verarbeitung: Apfelsaft pressen, Gemüse schneiden, Marmelade einkochen oder Kuchen backen. Dabei können die Bewohnenden, je nach Kraft und Interesse, mithelfen. Abschließend wird das Ergebnis genossen – zum Beispiel in einem geselligen Kaffeetrinken mit selbst gebackenem Apfelkuchen oder frisch gepresstem Saft.
Einbindung der Bewohnenden: Bewohner*innen können ab der Vorbereitung Schritt für Schritt aktiv werden. Gute Erinnerungsarbeit erzielt man, wenn sie schon früh in die Planung mit einbezogen werden (z. B. Gesprächsrunden zu Familien-Traditionen). Die konkrete Arbeit am Tag kann differenziert werden: Wer motorisch fitter ist, schneidet Obst oder bedient die Saftpresse, Schwächere machen Mitmachübungen (lassen Früchte riechen, Schalen fühlen). Als besonders bereichernd hat es sich erwiesen, wenn alle gemeinsam anpacken: In einem beschriebenen Projekt schnitten alle Beteiligten Äpfel, entkernte Pflaumen, während Erinnerungen an frühere Erntezeiten ausgetauscht wurden. Auch für Bettlägerige kann man sinnliche Erfahrung schaffen: Ein abgeschnittener Apfelzweig oder ein paar frische Zweige können ans Bett gebracht, der Geruch wahrgenommen werden.
Sicherheitsaspekte und körperliche Ressourcen: Es muss darauf geachtet werden, dass die Aktivitäten seniorengerecht bleiben. Wie Christine Baumann in einem Gartentherapie-Projekt betont, wird die Arbeit individuell angepasst: Mitarbeitende fragen sich, „wer kann noch mit einer Schere schneiden? Wer kann ... ein Blumengesteck binden?“. Ähnlich wählt man beim Ernten Hilfsmittel, die die Arbeit erleichtern: statt auf Leitern steigen manche mit Astscheren und Greifern vom Boden aus; statt Erntekörbe gibt es leichte Auffangkörbe oder Schubkarren; Bodenarbeiten geschehen im Sitzen auf Bänken. Hochbeete oder Pflanzkübel im Stehen entlasten Rücken und Knie. Wettergerechte Kleidung (Sonnenschutz, Regenjacken) und ausreichend Trinkpausen verhindern Erschöpfung. Medikamente, die Schwindel oder Kreislaufprobleme auslösen könnten, müssen besonders berücksichtigt werden. Erste-Hilfe-Set und eine zuständige Pflegekraft sollten stets verfügbar sein.
Varianten der Durchführung: Die Aktion kann auf verschiedene Weisen realisiert werden:
Im Heimgarten: Hat die Einrichtung eigene Obstbäume oder Beete, bietet es sich an, auf dem Gelände zu ernten. Die Wege sind kurz, die Szene vertraut. Ein Nachteil: Fällt die Ernte aus (nass, keine Bäume), braucht es Alternativen.
Besuch einer Streuobstwiese oder Bauernhof: Eine externe Wiese oder ein Obstgarten (oft öffentlich oder privat) kann besucht werden. Das bietet Abwechslung. Hier kann man evtl. in Gruppen aufteilen (eine Gruppe erntet, die andere bereitet vor Ort einen Pausenimbiss mit regionalen Produkten vor). Solche Ausflüge erfordern Transport, Begleitkräfte und Besucherfreigaben. Doch sie bringen einen Tapetenwechsel und können mit Lernelementen (Obstsorte kennenlernen, Bauer treffen) verbunden werden.
Kooperation mit örtlichem Obstbauern oder Lieferanten: Manche Obstbauern oder Mostereien bieten Kooperationen an, etwa vergünstigten Besuch oder Spenden von Press-Apfeln. Auch lokalen Vereinen (z. B. Naturschutzgruppe) kann man sich anschließen. In einem Beispielprojekt ernteten Flüchtlinge gemeinsam mit Betreuerteams Äpfel auf öffentlicher Fläche und pressten Saft – der soziale Austausch stand im Mittelpunkt. Ähnliches kann man mit Seniorengruppen organisieren.
Interne Variante „vom Feld ins Glas“: Wenn kein Garten vorhanden ist, kann man Feldobst kaufen (z. B. in einer Kiste vom Bauernmarkt) und in der Einrichtung pressen oder kochen. Hier entfällt zwar das Pflücken, aber alle anderen Schritte (Verarbeitung, gemeinsames Genießen) bleiben erhalten. Das kann als Mini-Projekt an einem verregneten Tag dienen.
Kulinarische und kreative Folgeangebote: Nach der Ernte bietet sich eine Reihe von Aktionen an, die das Thema vertiefen und weiter nutzen:
Essen und Trinken: Aus den geernteten Äpfeln kann Apfelsaft gepresst oder frischer Apfelmost hergestellt werden. Die Anleitung kann den Bewohnern übergeben werden – etwa „Wir machen Apfelsaft im Saftpresse“ und jeder kann Beeren dazugeben. Auch Apfelkompott, Apfelmus oder Gemüse-Marmeladen sind möglich. Danach wird gemeinsam gekocht oder gebacken: Apfelkuchen, Kompott, Gemüsesuppen mit Erntekräutern. Diese Tätigkeit steigert die Vorfreude, denn altbekannte Düfte (Zimt, Knoblauch, Kuchen) „wecken wunderbare Erinnerungen“. Das genussvolle Anrichten des Ertrags (z. B. als Dessert beim Abendessen) krönt die Aktion.
Basteln und Werken: Getrocknete Apfelscheiben, bunte Laubgestecke oder ein Erntedank-Kranz können mit den geernteten Früchten und Blättern gebastelt werden. Alte Rezepte herauszusuchen oder das Apfelernte-Thema künstlerisch umzusetzen (Gebete oder Lieder aufsagen, Gedichte schreiben) aktiviert Geist und Kreativität. Dabei können auch Angehörige oder Kinder mitwirken.
Gesundheit und Pflege: Ernten und Verarbeiten selbst sind schon rezeptfrei gesund: Beispielsweise liefert selbst gepflücktes Obst viele Vitamine und Mineralstoffe und ergänzt die Ernährung auf natürliche Weise. Pflegefachkräfte können diese Gelegenheiten nutzen, um zum Beispiel mit den Bewohnern über ihre Ernährung zu sprechen oder bei Obstverzehr Tipps zur Zahnpflege geben.
Beteiligung verschiedener Berufsgruppen: Eine Obsternteaktion bringt unterschiedlichste Mitarbeitende zusammen. Pflegekräfte garantieren Sicherheit und begleiten eventuell mobilitätseingeschränkte Bewohner. Betreuungskräfte (Gerontologen, Sozialarbeiter) planen die Aktivierungssequenz und animieren zum Mitmachen. Küchenpersonal übernimmt Rezepte, kalkuliert Zutaten und bereitet das gemeinsame Essen vor. Haustechnik stellt Gerätschaften (Pressen, Schläuche, Hochbeete) bereit und sorgt für Strom/Wasser. So wirken alle Berufsgruppen zusammen, was den Blick für interdisziplinäre Planung schult. Die Aktion kann auch als Teamevent dienen: Beispielsweise arbeiten Betreuende und Köche Hand in Hand beim gemeinsamen Schneiden von Obst, was die Kooperation fördert.
Integration von Ehrenamtlichen, Angehörigen und Nachbarschaft: Externe Helfer können eine große Bereicherung sein. Ehrenamtliche bringen oft Erfahrung und Geduld mit und können das Personal bei der Beaufsichtigung unterstützen. Angehörige können Früchte oder Zeit spenden, Kleinkinder einladen (Oma erzählt, wie man früher geerntet hat) und so Generationen einbinden. Manche Einrichtungen organisieren gemeinsam mit benachbarten Kindergärten Erntefeste: Kinder singen Lieder (z. B. über Äpfel), die Senioren können ihr Wissen weitergeben – „Äpfel sind gesund!“ – und eine generationsübergreifende Feier entsteht. So werden die Bewohnenden gewissermaßen „zum Mittelpunkt“ einer kleinen Gemeinschaft, denn sie können ihr Wissen an jüngere Generationen weitergeben und gemeinsam den Ertrag genießen.
Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit: Nachbereitung und Reflexion sind wichtige Elemente. Fotos oder Filme von der Ernte, Berichte im Hausjournal oder auf der Website zeigen nach außen, wie lebendig das Heim ist. Die Ernteaktion kann als schönes Beispiel dienen, um in Presse oder sozialen Medien über das Engagement der Einrichtung zu berichten. Das steigert die Identifikation der Mitarbeitenden und Bewohnenden mit dem Haus und kann auch im Marketing genutzt werden. Gleichzeitig werden neue Ideen gesammelt: Was hat gut funktioniert? Welche Nachfolgeprojekte (z. B. „Apfelwoche“ mit täglichen Aufgaben) könnten sich daraus entwickeln?
Umsetzung in der Praxis: Projektablauf mit Varianten
Um eine konkrete Vorstellung zu geben, sei hier ein exemplarischer Ablauf für eine Apfelernteaktion dargestellt. Er umfasst Planung, Durchführung und Abschluss in einem typischen Pflegeheim-Umfeld:
Projektvorbereitung (ca. 2–3 Monate vorher): Ein kleines Team aus Betreuungskräften, Pflegepersonal und Küche bildet eine „Ernte-AG“. In einem ersten Treffen werden Ziele festgelegt (z. B. Apfelsaft herstellen, Apfelkuchen backen). Aufgaben werden verteilt: Wer kümmert sich um Obstbäume auf dem Gelände, wer kontaktiert lokale Bauern? Ein Budget wird kalkuliert (Einmachzubehör, Saftpresse mieten, ggf. Transportkosten). Gegebenenfalls wird die Aktion mit einer Pflegestandortkonferenz abgestimmt und vom Heimleitung genehmigt. Mitarbeitende werden per Aushang über das Projekt informiert und eingeladen, sich einzubringen. Angehörige können frühzeitig per Rundbrief über die Pläne informiert werden (zur Erntezeit, bei Bedarf zur Mithilfe oder Spende von Obst).
Resourcen sichern (ca. 1 Monat vorher): Das Team prüft die Obstlage. Wenn im Heimgarten Apfelbäume stehen, wird der Reifegrad beurteilt (durch Abdrücken einer Frucht). Falls keine Bäume vorhanden oder Früchte unbrauchbar sind, wird der Kontakt zu einer Streuobstwiese oder einem Bauern aufgebaut. Hier kann man Erlaubnis einholen, selbst zu ernten, oder Äpfel erwerben. Eventuell organisiert man zusammen mit einem Bauern, dass dieser mit Aufsichtsrecht die Ernte auf seinem Feld durchführt. Für die Unternehmung wird Transport (Bus, Kleinbus) rechtzeitig reserviert. Werkzeuge (Astscheren, Sammelkörbe), Saftpresse oder Einmachgeräte werden bereitgestellt (teils geliehen oder bestellt). Einhänge auf die Aktion (Flyer, Erinnerungszettel) regen Bewohnende an, sich daran zu beteiligen.
Vollständiger Beitrag auf:
Hauptseite Steady Blog - Aktivierungen ( > 2000 Aktivierungen inkl. Lexikon ab 9 € Monatlich)
oder – falls Sie nur die Lexikon-Beiträge lesen möchten – direkt unter Steady - Lexikon der sozialen Betreuung (Fachliche Sammlung für Betreuungskräfte ab 3 € Monatlich).










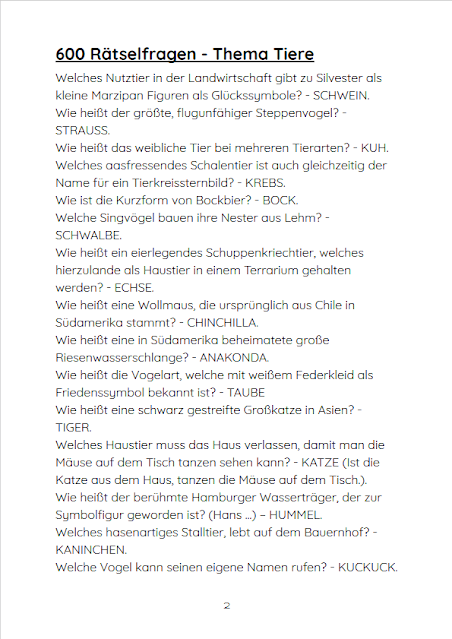
Kommentare
Kommentar veröffentlichen