Validation
Einführung in das Konzept der Validation
Validation (von engl. „to validate“ = bestätigen, für gültig erklären) ist eine Kommunikationstechnik, die von Gerontologin Naomi Feil in den 1960er Jahren entwickelt wurde. Sie richtet sich vor allem an hochbetagte, desorientierte Menschen (insbesondere mit Demenz) und setzt auf Empathie und Akzeptanz anstelle von Belehrung. Das oberste Prinzip lautet, „in den Schuhen des Anderen zu gehen“, d.h. die subjektive Erlebniswelt der Betroffenen ernst zu nehmenppm-online.orgdgpalliativmedizin.de. Feil geht davon aus, dass viele Symptome alter Menschen auf ungeklärten biografischen Konflikten beruhen, denen man mit Zuwendung begegnen kann. In Deutschland hat Nicole Richard die Integrative Validation weiterentwickelt, die weniger auf Vergangenheitskonflikte abzielt, sondern das aktuelle Erleben erleichtert. Unabhängig vom Ansatz steht bei allen Validationsmethoden der Mensch mit seinen Gefühlen und seiner Würde im Mittelpunkt. Validation ist mehr eine wertschätzende Grundhaltung als ein stures Therapieschema – sie befähigt, Verwirrung und Irritation des alten Menschen als gültige Gefühlsäußerungen zu akzeptieren statt zu korrigieren.
Zielsetzung der Validation
Ziel der Validation ist es, die seelische und emotionale Lage alter Menschen zu verbessern und ihnen Geborgenheit zu vermitteln. Im Fokus steht, den Betroffenen Sicherheit und Akzeptanz zu geben, ihr Selbstwertgefühl zu stärken und Würde zu erhalten. Konkret bedeutet das, Anspannung oder Angstzustände zu reduzieren, Zugehörigkeit zu vermitteln und die persönliche Identität zu unterstützen Validation fördert einen ruhigen, respektvollen Umgang und kann dadurch das Wohlbefinden steigern: Man beobachtet häufig eine verbesserte Kommunikation, mehr soziale Aktivität und weniger Rückzug bei den Bewohnern. Auch Pflegekräfte und Angehörige profitieren: Wenn die Umgebung einfühlsam reagiert, sinkt der Pflegeaufwand für aggressive oder ängstliche Verhaltensweisen, und die Beziehung wird harmonischer. Wichtig ist, dass Validation nicht heilt, sondern die Lebensqualität im Hier-und-Jetzt unterstützt. Sie zielt darauf ab, Leiden zu lindern und Kommunikation zu fördern, nicht die Demenz aufzuhalten.
Vorteile und Nachteile der Validation
Vorteile: Validation bietet einen sehr einfühlsamen Zugang zu Demenzkranken. Sie betont, den Menschen als Individuum mit eigener Realität wahrzunehmen, statt ihn zu korrigieren. Studien und Erfahrungsberichte zeigen, dass Validationsgespräche oft zu besseren Sprachäußerungen, weniger Angst und gesteigerter Aktivität führen. Pflegepersonen berichten, dass Akzeptanz und Verständnis Stress mindern und das Vertrauen stärken. Zudem ist Validation kostengünstig: Man benötigt keine teure Technik, sondern nur Zeit, einfache Alltagshilfen (z.B. Lieder, Bilder, Sprichwörter) und eine achtsame Haltung. Durch Resonanz („Spiegeln“) der Gefühle fühlen sich viele Betroffene ernst genommen und erleben Erfolgserlebnisse.
Nachteile: Kritiker weisen darauf hin, dass Validation gelernt und eingeübt sein muss. Ohne Schulung kann die Methode hilflos wirken oder falsch angewendet werden. Manche sehen die psychodynamischen Annahmen (wie ungelöste Lebenskonflikte) kritisch, da sie wissenschaftlich schwer belegbar sind. Ein weiteres Risiko ist, dass Pflegende unrealistische Erwartungen entwickeln könnten, etwa zu glauben, Validation könne die Demenz stoppen – dies kann zu „Helfersyndrom“ und Erschöpfung führen. In der Forschung gibt es bislang keine klaren Belege, dass Validation kognitive Fähigkeiten nachhaltig verbessert. Zusammenfassend ist Validation vielversprechend für das Wohlbefinden, erfordert aber Zeit und Fingerspitzengefühl.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung der Validation
Für ein erfolgreiches validierendes Gespräch ist eine ruhige, wertfreie Grundhaltung notwendig. Nehmen Sie sich vorab einen Moment, um sich zu sammeln. Herstellen Sie durch Blickkontakt und Namensansprache eine vertrauensvolle Atmosphäre. Beginnen Sie dann mit einfachen, offenen Fragen oder Bemerkungen. Beobachten Sie genau, wie sich der Betroffene fühlt (Blick, Gestik, Mimik geben Hinweise auf seine Emotionen).
Gefühle wahrnehmen und ansprechen: Versuchen Sie zu verstehen, welche Emotionen hinter den Worten oder dem Verhalten des Bewohners stecken (z.B. Angst, Einsamkeit, Trauer). Formulieren Sie dies in klaren, kurzen Sätzen und passen Sie Sprache und Ton an die Person an. Zum Beispiel: „Sie sehen ganz aufgeregt aus, das macht Sie wohl ängstlich.“
Emotional spiegeln: Akzeptieren Sie die empfundenen Gefühle als echt und verständlich. Sagen Sie zum Beispiel: „Ich merke, wie traurig Sie sind, weil…“. So zeigen Sie, dass Sie seine Gefühlswelt ernst nehmen und nachvollziehen.
Gefühle bestätigen (Validation): Bestärken Sie, dass dieses Gefühl „in Ordnung“ ist. Häufig hilft es, mit bekannten Sprichwörtern oder Erinnerungen zu antworten, die die Emotionen würdigen. Alte Volksweisheiten und Lieder liegen in der Erinnerung parat und können etwa so eingesetzt werden: „Es ist normal, dass Sie Ihre Familie vermissen – früher sagte man: ‘Heimat ist da, wo das Herz ist.’“. Dadurch begreift der Betroffene, dass seine Gefühle nicht falsch sind.
Achten Sie dabei darauf, niemals zu widersprechen oder zu korrigieren. Sprechen Sie langsam, deutlich und bleiben Sie authentisch. Geben Sie dem Menschen viel Zeit, auf Ihre Worte zu reagieren. Wenn möglich, schließt ein gemeinsames Ritual das Gespräch ab (ein Lied, eine Umarmung oder eine Aktivität), um die positive Stimmung zu festigen.
Umsetzung in der Praxis mit konkreten Beispielen
In der Pflege kommen Validationstechniken in vielen Alltagssituationen zum Einsatz. Ein Beispiel: Frau S. ruft wiederholt nach ihrer verstorbenen Mutter und wirkt dabei aufgeregt. Die Pflegende geht ruhig zu ihr und sagt einfühlsam: „Sie suchen Ihre Mutter – das macht Sie ganz traurig, nicht wahr?“ Anstatt zu korrigieren, spiegelt sie: „Früher war sie immer für Sie da, das fehlt Ihnen jetzt.“ Sie kann ein vertrautes Lied anstimmen oder ein Sprichwort wie „Wer in guten Händen war, dem fehlt die Wärme“ hinzunehmen. Durch diese Bestätigung fühlt sich Frau S. verstanden und beruhigt.
Ein zweites Beispiel: Herr M. wirkt morgens sehr still. Eine Fachkraft setzt sich zu ihm, hält sanft seine Hand und fragt behutsam: „Sie sehen nachdenklich aus. Erzählen Sie mir doch, was Sie beschäftigt.“ Oft können allein diese Worte Trost spenden. Vielleicht fällt ihm ein altes Gedicht ein, an das er sich erinnert; das gemeinsame Nachsprechen gibt ihm Wertschätzung und Verbundenheit.
Vollständiger Beitrag auf:
Hauptseite Steady Blog - Aktivierungen ( > 2000 Aktivierungen inkl. Lexikon ab 9 € Monatlich)
oder – falls Sie nur die Lexikon-Beiträge lesen möchten – direkt unter Steady - Lexikon der sozialen Betreuung (Fachliche Sammlung für Betreuungskräfte ab 3 € Monatlich).






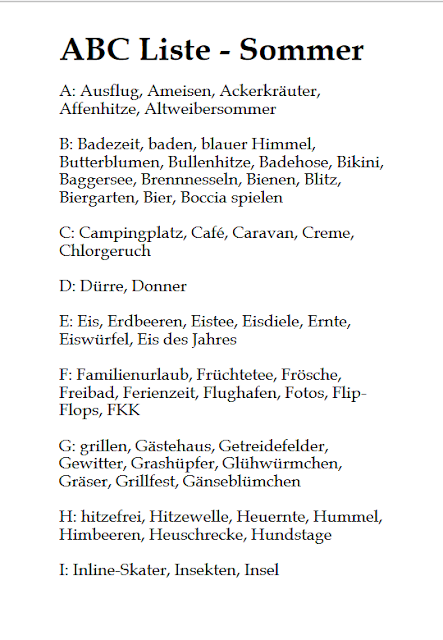
%20-%20schlagerrtsel.pdf.png)



Kommentare
Kommentar veröffentlichen