Balancier- und Koordinationsübungen im Alter
Mit zunehmendem Alter nehmen Gleichgewicht und Koordinationsfähigkeit ab. Ein Drittel aller 65-Jährigen und etwa die Hälfte der 70-Jährigen stürzt mindestens einmal pro Jahr. Dieses Risiko ist bei Demenzkranken noch höher. Wenn Bewegungsabläufe unsicher werden, erschöpft dies das Selbstvertrauen und es droht ein Teufelskreis aus Angst, Schonhaltung und Gebrechlichkeit. Durch gezielte Balance- und Koordinationsübungen können ältere Menschen ihre Mobilität erhalten und Stürzen vorbeugen.
Zielsetzung
Das Hauptziel von Balancier- und Koordinationsübungen im Seniorenalter ist die Sturzprävention. Durch gezielte Übungen werden Stand- und Gangstabilität verbessert und Muskulatur aufgebaut. Studien belegen, dass regelmäßiges Gleichgewichtstraining das Sturzrisiko um bis zu 40 % senken kann. Zugleich fördern Koordinationsübungen die kognitiven Fähigkeiten (z. B. Aufmerksamkeit und Konzentration), was die Mobilität und Selbstständigkeit im Alltag unterstützt. Weitere Ziele sind die Förderung des Körperbewusstseins, des Gleichgewichtsinneren und des Muskeltonus, was insgesamt dazu beiträgt, Bewegungskompetenz und Lebensqualität im Alter zu erhalten.
Zielgruppenorientierte Vorteile und Nachteile
Rüstige Senioren:
Vorteile: Sehr fitte Senioren können komplexe Übungen durchführen und dadurch Kraft, Koordination sowie Gelenkbeweglichkeit auf hohem Niveau halten. Gruppentraining steigert Motivation und soziale Kontakte. Das Erfolgserlebnis bei verbesserter Balance stärkt das Selbstvertrauen.
Nachteile: Für sehr leistungsfähige Senioren kann das Standardprogramm zu einfach sein. Das Training muss anspruchsvoll angepasst werden, sonst drohen Langeweile oder Überforderung durch zu rasche Steigerung. Ausreichend Pausen sind zu berücksichtigen, um Erschöpfung oder Verletzungen zu vermeiden.
Senioren mit Sturzrisiko:
Vorteile: Menschen mit eingeschränkter Mobilität profitieren stark von sanftem Balance- und Koordinationstraining. Langsam gesteigerte Übungen verbessern gezielt Kraft und Standstabilität. Das Vertrauen in den Körper wächst, sodass Betroffene selbstbewusster gehen und Alltagssituationen sicherer meistern.
Nachteile: Bei deutlichen Einschränkungen oder akuten Beschwerden muss die Sicherheit oberste Priorität haben. Übungen sind unbedingt individuell anzupassen und oft unter Anleitung durchzuführen. Fehlende Stabilität erfordert Hilfestellung (z. B. Haltegriffe, Stuhl) – sonst besteht bei schwierigen Übungen weiterhin Sturzgefahr.
Senioren mit Demenz:
Vorteile: Selbst bei leichter bis mittlerer Demenz erhalten regelmäßige Koordinationsübungen die Bewegungsfähigkeit im Alltag. Zudem wirken sie sich positiv auf geistige Fähigkeiten wie Konzentration und Reaktionsvermögen aus. Spielerische Elemente und Wiederholungen können die Teilnehmenden aktivieren, da Wiederholung und Rhythmus leicht verständlich sind.
Nachteile: Demenzkranke benötigen klare, einfache Anweisungen und gegebenenfalls Handführung. Das Training muss langsam und in leicht verständlicher Form erfolgen. Erfolge stellen sich verzögert ein, daher ist Geduld gefragt. Zudem erfordert die räumliche Absicherung (z. B. rutschfester Boden, stützende Hilfsmittel) erhöhte Aufmerksamkeit.
Gemischte Gruppen:
Vorteile: Bewegungsangebote in gemischten Gruppen (z. B. Senioren mit und ohne Mobilitätseinschränkung) bieten sozialen Austausch und wechselseitige Motivation. Der soziale Aspekt und gemeinsame Spaß steigern die Trainingsbereitschaft. Unterschiedlich starke Teilnehmer können sich gegenseitig ermutigen.
Nachteile: Die Übungsinhalte müssen differenziert werden: Zu schnelle Abläufe überfordern manche, andere können sich gelangweilt fühlen. Ein gutes Gruppentraining erfordert daher mehrere Niveaus (z. B. Paare, die langsam/ schneller arbeiten). Ansonsten können Überforderung oder Sicherheitsprobleme auftreten. Ausreichende Betreuung und Betreuungspersonal sind in gemischten Gruppen besonders wichtig.
Anleitung zur praktischen Umsetzung
Vorbereitung und Planung
Informieren Sie sich über die Fähigkeiten der Teilnehmenden: Gesundheitszustand (z. B. Herz-Kreislauf, Gelenkprobleme) und frühere Bewegungserfahrungen. Ein kurzes Gespräch zur Mobilität und den Erwartungen hilft bei der Planung. Safety-Check: Wählen Sie einen möglichst ebenen, rutschfesten Übungsraum. Entfernen Sie Stolperfallen (Teppiche, herumliegende Gegenstände) und achten Sie auf gute Beleuchtung und Temperatur. Stellen Sie einen stabilen Stuhl oder Haltegriff in Reichweite, an dem man sich bei Bedarf festhalten kann. Prüfen Sie Schuhe (geschlossene, rutschfeste) und bequeme Kleidung bei den Teilnehmern. Legen Sie ausreichend Platz und eventuell weiche Unterlagen (Matten) bereit. Sorgen Sie für einen Beistellstuhl oder Ablage, auf dem Teilnehmer Getränke (Wasser) abstellen können.
Planen Sie auch organisatorisches: Terminabsprachen (regelmäßig, feste Zeiten) geben Struktur. Klären Sie mit Kollegen oder Angehörigen die Teilnahme. In Pflegeeinrichtungen können Sie das Training in den Wochenplan einbauen. Für Personen mit hohem Sturzrisiko empfiehlt sich zuvor eine ärztliche Freigabe. Vor Beginn sollte eine Aufwärmphase stattfinden (z. B. leichtes Gehen, Schulterkreisen) – dies lockert die Muskulatur. Gehen Sie methodisch vor: Jede Einheit sollte ein klares Ziel haben (z. B. „Heute üben wir einbeinige Standfestigkeit“). Legen Sie für jede Übung Beginn, Dauer und Wiederholungen fest.
Auswahl geeigneter Übungen und Hilfsmittel
Wählen Sie Übungen an den Fähigkeiten der Zielgruppe aus. Ohne Geräte genügen körpereigene Übungen: Einbeinstand, Tandemstand (Ferse-Zehen-Stellung), beidseitiges Anheben der Knie im Stand oder Sitzen – das alles trainiert Balance. Alltagsgegenstände können einbezogen werden: auf eine Linie (z. B. Klebeband) gehen oder den Fuß über ein Handtuch abrollen stärkt das Gleichgewicht spielerisch.
Mit Hilfsmitteln können Sie das Training variieren:
Balance-Geräte wie Wackelbrett, Therapiekreisel oder Balancekissen schaffen eine instabile Unterlage, die das Gleichgewicht intensiv fordert.
Koordinationsleitern (am Boden ausgelegte Leiterelemente) werden durchgeschritten oder gesprungen, um Schrittkoordination und Agilität zu verbessern.
Therabänder, Gymnastikbälle oder –hanteln (leichte Gewichte) eignen sich, um zeitgleich Kraft aufzubauen. Beispielsweise lassen sich Schulterübungen mit einem Gymnastikband kombinieren.
Stütz- und Sicherungsobjekte: Ein Stuhl, ein Geländer oder Haltegriff geben Sicherheit. Anfangs kann man sich bei schwierigen Übungen mit der Hand abstützen. Rutschfeste Unterlagen oder Teppiche verhindern Ausrutschen.
Kleine Bälle oder Sandsäckchen trainieren Feinmotorik und Auge-Hand-Koordination (z. B. Werfen und Fangen).
Alltagsmaterialien: Zeitungstüten oder Handtücher können statisch belastet oder zwischen den Knien zusammengedrückt werden, um Stabilität zu trainieren.
Nutzen Sie Hilfsmittel dosiert: Beginnen Sie mit leichteren Varianten (z. B. beide Hände am Stuhl) und steigern Sie langsam die Schwierigkeit (z. B. Hände frei, auf instabilem Kissen). Variieren Sie die Übungsauswahl je nach Tagesform.
Übungen im Sitzen und im Stehen
Im Sitzen lassen sich viele koordinative Grundbewegungen üben, wenn sich die Teilnehmenden nicht sicher stehen können. Beispiele: „Äffchen“ (linke Hand zur Stirn, während die rechte kreist) oder „Schnur und Straks“ (rechte Hand zeichnet ein Dreieck, linke eine Linie). Auch Schulterkreisen, Rumpfdrehen und das langsame Abspreizen sowie Zusammenführen der Arme oder Beine trainiert Koordination. Dabei sollten Rücken und Beine gut auf dem Stuhl abgestützt sein. Sitzend kann man zudem mit den Armen kleine Bälle oder Sandsäckchen zuwerfen, um Auge-Hand-Koordination zu fördern. Sitzübungen sind besonders wichtig für Personen mit größerer Unsicherheit oder Demenz, da sie schonend für Gelenke sind.
Im Stehen liegt der Fokus auf dem Gleichgewicht. Hier sind klassische Standübungen wirkungsvoll:
Einbeinstand: Auf einem Bein stehen, gegebenenfalls neben einem Stuhl zur Sicherheit. Dabei den Oberkörper aufrecht halten. Anfangs 5–10 Sek. pro Seite, mit zunehmender Sicherheit verlängern.
Tandemstand: Einen Fuß direkt vor den anderen stellen, als würde man einer Linie folgen. Position halten (30 Sek. oder länger).
Gewichtsverlagerungen: Im hüftbreiten Stand das Gewicht langsam abwechselnd von einem Bein auf das andere verlagern. Der Oberkörper bleibt dabei aufrecht.
Kreisbewegungen: Auf einem Bein stehen, mit dem anderen Fuß kleine Kreise auf dem Boden malen, dann Bein wechseln.
Fersen-Zehen-Stand: Abwechselnd auf Fersen und auf Zehenspitzen stehen und dabei Oberkörper leicht nach vorne bzw. hinten bewegen.
Zur Steigerung können kleine Armbewegungen hinzugefügt werden (z. B. abwechselnd nach oben greifen, während man im Einbeinstand ist). Alltagsbewegungen einbeziehen: Das Treppensteigen bewusst üben, Stufen einzeln gehen und sichern. Auch Aufstehen und Hinsetzen (ohne Armstütze) ist eine hilfreiche Übung für Standfestigkeit und Koordination.
Durchführung und Ablauf
Beginnen Sie jede Einheit mit Aufwärmen: Lockernde Bewegungen wie Nicken oder Kippen des Beckens, Fersen-Zehen-Gang oder leichtes Gehen an Ort und Stelle. Erklären Sie den Zweck jeder Übung kurz und verständlich. Demonstrieren Sie die Übung, bevor die Teilnehmer sie selbst durchführen. Ermutigen Sie die Senioren, langsam zu arbeiten und auf ihren Körper zu hören.
Anleitung: Geben Sie klare, kurze Anweisungen (z. B. „Wir üben jetzt das Knieheben: Halten Sie sich an der Stuhllehne fest und heben Sie abwechselnd das Knie zur Brust“). Motivieren Sie durch positives Feedback. Führen Sie die Übung selbst vor oder lassen Sie einen Teilnehmer vorzeigen. Beginnen Sie mit wenigen Wiederholungen (z. B. 5–10 Mal) und steigern Sie allmählich die Anzahl oder Dauer. Unterbrechen Sie die Übung für Pausen, wenn sich jemand schwindlig fühlt.
Unterstützung: Bieten Sie Hilfestellung an (Hände, Hand oder ein Band). Bei Bedarf kann ein Trainer mitlaufen oder nah bleiben. Partner- oder Gruppenübungen (z. B. Gegenseite stützen) erhöhen die Sicherheit. Achten Sie strikt darauf, dass keine Schmerzen auftreten. Die Übungen sollten schwierig genug sein, um zu fordern, aber nicht überfordern.
Nachbereitung: Schließen Sie mit einer Cool-Down-Phase ab (z. B. leichtes Strecken oder langsames Sitzen), sodass sich die Muskulatur wieder entspannt. Belohnen Sie die Teilnehmer mit Anerkennung für ihre Leistung. Erinnern Sie daran, nach dem Training Wasser zu trinken. Kleine Motivationstipps wie Fortschrittsdiagramme oder Bestätigungen können helfen, dran zu bleiben. Empfehlenswert ist, Übungen regelmäßig durchzuführen – idealerweise 2–3 Mal pro Woche mit je 15–30 Minuten. Kürzere tägliche Einheiten sind oft effektiver als seltene, lange Belastungen.
Begleitende Maßnahmen: Motivation und Gestaltung
Gestalten Sie die Übungseinheit abwechslungsreich und unterhaltsam. Musik lockert auf: Ein bekanntes Lied oder Rhythmus regt zum Mitbewegen an. Nutzen Sie kleine Tänze oder Rhythmusübungen (gemeinsames Klatschen oder Schuhe-Locken), um den Beginn dynamisch zu gestalten. Biografie-Impulse: Binden Sie Erinnerungen ein (z. B. Lieblingsmusik aus der Jugend, bekannte Volkslieder). Erzählen Sie humorvolle Anekdoten oder stellen Sie Quizfragen zwischendurch, um auch geistige Aktivität anzuregen. Gespräche und Lob: Gehen Sie auf die Teilnehmer ein, hören Sie zu. Gedächtnisstützen aus der Biografie (Fotos, kurze Geschichten) können den Übungskontext persönlicher machen. Loben Sie Fortschritte offen, um Selbstbewusstsein zu stärken. Entspannung: Kleine Entspannungsübungen nach dem Training (ruhiges Atmen, sanftes Schaukeln) runden die Einheit ab und vermeiden Muskelverspannungen.
Praktische Hinweise für verschiedene Betreuungskontexte
Einzelbetreuung (Haus, Pflegeheim): Hier können Übungen individuell angepasst werden. Der Betreuer hat volle Kontrolle und kann direkt eingreifen. Diese Form eignet sich, wenn Senioren stark eingeschränkt sind oder keine Gruppe verfügbar ist. Schaffen Sie in der Wohnung einen festen Übungsplatz (z. B. neben einem Stuhl). Ein Familienmitglied oder Pflegedienstmitarbeiter kann als Begleitperson fungieren. Wichtig ist, die Anleitungen langsam zu geben und stets unterstützend zur Seite zu stehen.
Gruppenangebot (Tagespflege, Seniorengymnastik): In Gruppen macht das Training oft mehr Spaß und motiviert langfristig. Teilen Sie die Teilnehmer nach Können auf (z. B. zwei Reihen mit unterschiedlicher Übungsschwierigkeit). Setzen Sie Musik ein und rufen Sie alle Personen mit Namen. In Einrichtungen bieten sich feste Termine (z. B. jeden Montag- und Mittwochmorgen) an. Achten Sie auf genügend Betreuungspersonal, besonders bei gemischten Leistungsklassen, damit jeder passende Unterstützung erhält. Gruppentraining kann zusätzlich kognitive Anreize enthalten (z. B. gemeinsam zählen, Liedtext mitsingen).
Stationäre Pflege: Hier werden oft Bewegungskurse von Physiotherapeuten oder geschultem Pflegepersonal geleitet. Nutzen Sie vorhandene Therapieräume oder Gemeindehallen. In Pflegeheimen können regelmäßige Gymnastikstunden in den Tagesablauf integriert werden. Manche Einrichtungen kombinieren die Übungen mit Physiotherapie (z. B. Gymnastik im Sitzen mit dem Physiotherapeuten). Bei Demenzgruppen sollte der Raum ruhig und gut strukturiert sein (feste Platzordnung, wiederkehrende Abläufe).
Tagespflege: Kurseinheiten können in Kleingruppen stattfinden. Dort ist meist ausreichend Platz und Equipment vorhanden. Achten Sie auch auf Ausgleich von Belastungs- und Ruhephasen, weil Tagesgäste oft ein volles Programm haben.
Häusliche Betreuung: In der häuslichen Pflege können Pflegekräfte kurze Übungen im Alltag einbauen (beim Zähneputzen, in der Küche). Pflegedienste können Angehörige anleiten und motivieren, dass diese tägliche Übungsphasen unterstützen. Kurse oder Videos für Zuhause (z. B. über Krankenkassen) können eine Hilfestellung bieten.
In allen Bereichen gilt: Eine positive Atmosphäre (freundliche Anrede, humorvolle Atmosphäre) und feste Regelmäßigkeit sind entscheidend. Auch kleine Erfolgserlebnisse, etwa ein längerer Einbeinstand als zuvor, sollten dokumentiert und gefeiert werden, um die Motivation hoch zu halten.
Konkrete Übungsbeispiele
Die Übungen lassen sich an verschiedene Leistungsniveaus anpassen. Hier einige konkrete Beispiele:
Vollständiger Beitrag auf:
Hauptseite Steady Blog - Aktivierungen ( > 2000 Aktivierungen inkl. Lexikon ab 9 € Monatlich)
oder – falls Sie nur die Lexikon-Beiträge lesen möchten – direkt unter Steady - Lexikon der sozialen Betreuung (Fachliche Sammlung für Betreuungskräfte ab 3 € Monatlich).








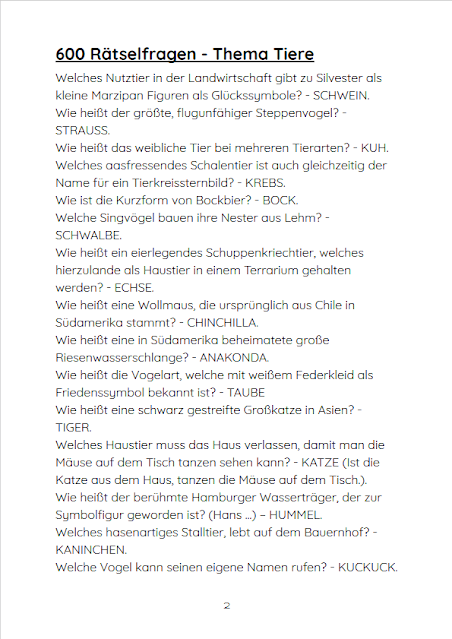


Kommentare
Kommentar veröffentlichen